Die EU-Kommission hat in ihrem Arbeitsprogramm für das Jahr 2025 einen ersten Entwurf für einen „Europäischen Schutzschild für Demokratie“ / „European Democracy Shield“ angekündigt; im Europäischen Parlament hat sich im Februar 2025 ein korrespondierender Sonderausschuss konstituiert. Die Initiative hat das erklärte Ziel, Desinformation zu bekämpfen und Wahlen sowie die Zivilgesellschaft zu schützen. Die kommunale Ebene, auf der ein großer Teil des zivilgesellschaftlichen Engagements stattfindet, spielt in den bisherigen Vorschlägen für den Europäischen Schutzschild für Demokratie jedoch kaum eine Rolle. Vor diesem Hintergrund lud die niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung Wiebke Osigus zu einer Diskussionsveranstaltung über Desinformation in der Kommunalpolitik in der Vertretung des Landes Niedersachsen bei der Europäischen Union in Brüssel ein.
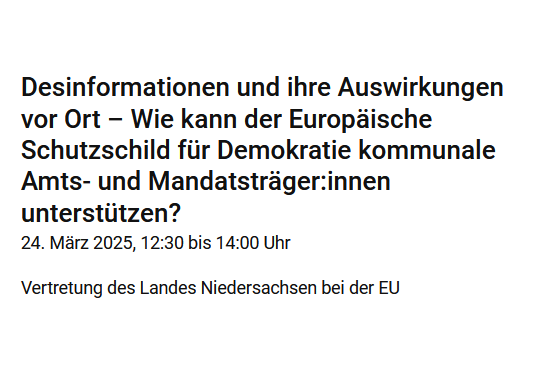
Institutsmitarbeiter Joschua Helmer diskutierte die Frage mit Alexandra Geese (MdEP), Dr. Klaus Nutzenberger (Deutscher Städte- und Gemeindebund), Lina Furch (Deutscher Städtetag), Thomas Otto (Bürgermeister der Gemeinde Saterland) und Bettina Praetorius (Frauen aufs Podium e.V.). Annabell Brockhues (Deutschlandradio) moderierte. Die Diskussion lässt sich hier im Stream nachschauen.
Kommunale Herausforderungen und EU-Digitalpolitik zusammendenken
In seinem Beitrag betonte er die Relevanz der kommunalen Ebene als Stabilisator der Demokratie. Im Niedersächsischen Demokratiemonitor zeigen sich 51% der Befragten zufrieden mit der Politik in ihrer Gemeinde; ein weiteres Drittel tut dies zumindest zum Teil. Die Zufriedenheit mit der Landespolitik fällt etwas, die mit der Bundes- und EU-Politik weit geringer aus.
Dabei ist auch die Kommunalpolitik nicht frei von Konflikten. Explosiv werden diese häufig, wenn es um Geflüchtetenunterkünfte oder um lokale Energiewendeprojekte geht – letztere wurden im Institut für Demokratieforschung u.a. im Rahmen des Demokon-Projekts erforscht. Hierbei lassen sich seit einigen Jahren auch strategische Interventionen überregionaler rechtsradikaler Akteure in lokale Konflikte und eine Raumnahme radikaler Netzwerke vor Ort konstatieren. So waren etwa lokale Proteste von Querdenken & Co während der Covid-19-Pandemie im Hinblick auf die Anzahl der Teilnehmenden überschaubar, dabei jedoch geografisch so weit verästelt wie keine andere Protestbewegung der Nachkriegsgeschichte. Zusammen mit einer oft sehr angespannten finanziellen Lage stellen diese Dynamiken die Kommunalpolitik vor Herausforderungen.
Der Europäische Schutzschild für Demokratie ist eine nicht-legislative Initiative aus dem „European Democracy Action Plan“ und soll die Ansätze zum Schutz der Wahlen zum Europäischen Parlament 2024 vor ausländischer Einflussnahme ausweiten und verstetigen. Dafür soll die Abwehr von strategischen Desinformationskampagnen („foreign information manipulation and interference“, kurz FIMI) intensiviert und die Förderung von unabhängigem Journalismus ausgebaut werden. Dabei soll der Schutzschild sowohl mit einer Regulierung der Finanzierung europäischer Parteien und Stiftungen als auch mit der Umsetzung des „Gesetz über digitale Dienste“ / „Digital Services Act“ (DSA) abgestimmt werden, das als EU-Verordnung digitale Plattformen reguliert.
Wie dies gelingen kann, welche Rolle Desinformation in der Kommunalpolitik hat und wie kommunales Engagement angemessen berücksichtigt werden kann, wurde auf der Veranstaltung diskutiert.
