[gastbeitrag]: Thomas Großbölting erkundet das religiöse Feld in Deutschland 2017.
Wer versucht, sich über das religiöse Feld im Deutschland des Jahres 2017 einen Überblick zu verschaffen, der wird mit einem in sich höchst diversen Befund konfrontiert: In den Feuilletons, in der Kulturszene und auch im politischen Diskurs ist Religion hoch präsent. Das ist in diesem Jahr vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, Martin Luther und dem 500-jährigen Reformationsjubiläum zu verdanken. Als Playmobilfigur, als Filmheld, als Stoff für zahlreiche Biografien, aber auch als Aufhänger für politische Reden: Dem Reformator entkommt man in diesem Jahr nicht.
Der hohen Aufmerksamkeit für die Religion als Kulturfaktor und -event steht ein zweites Moment entgegen. In den großen Religionsgemeinschaften selbst, sprich: in der Katholischen und der protestantischen Kirche, dominiert seit Jahrzehnten ein Krisendiskurs, der – je nach Temperament und (kirchen-)politischer Ausrichtung des Sprechers – in beruhigende oder apokalyptische Farben getaucht wird: Abbruch, Erosion, Veränderung. „Kirche schafft sich ab“ titelte bspw. noch Ende Januar 2017 die Frankfurter Allgemeinen Zeitung.[1] Zumindest in den Ingroups der Kirchen, so lässt sich daran wie auch an zahlreichen weiteren Beispielen zeigen, ist die Krisenwahrnehmung weitverbreitet.
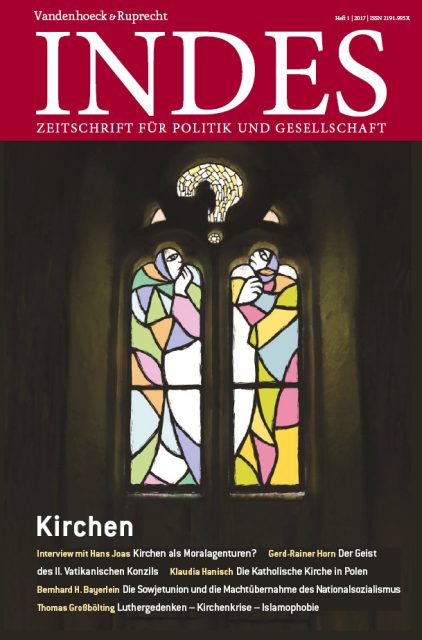 Diese merkwürdige Diskrepanz von kultureller Beachtung und interner Krisenrhetorik in den zwei Konfessionskirchen wird gerahmt von einem dritten Religionsdiskurs, in dem nicht die christlichen Großkonfessionen im Vordergrund stehen, sondern der Islam. Wenn Religion negative Schlagzeilen macht, dann rühren diese in der Regel aus einer von zwei Richtungen: Entweder betreffen sie Skandale der etablierten Konfessionen; oder sie thematisieren den Umgang mit der in Deutschland vermeintlich „neuen“ Religion des Islam, der wechselweise als fremd oder terroristisch, auf jeden Fall aber als Bedrohung wahrgenommen wird. Die individuelle Bindung an das Überzeitliche wird hier als Bedrohung für die Gesellschaft skizziert und diese vor allem „außen“ verortet. Der Islam gilt als Gefahr, die den gesellschaftlichen Frieden infrage stellt. Dass dieser Gefährdungswahrnehmung von Teilen des Rechtspopulismus das „christliche Abendland“ als politische Zielvision und Abwehrmechanismus entgegengehalten wird, ist auf den ersten Blick ein verwirrender Befund, schließt aber – so lässt sich bei genauerem Hinsehen zeigen – durchaus an die anfänglichen Beobachtungen an.
Diese merkwürdige Diskrepanz von kultureller Beachtung und interner Krisenrhetorik in den zwei Konfessionskirchen wird gerahmt von einem dritten Religionsdiskurs, in dem nicht die christlichen Großkonfessionen im Vordergrund stehen, sondern der Islam. Wenn Religion negative Schlagzeilen macht, dann rühren diese in der Regel aus einer von zwei Richtungen: Entweder betreffen sie Skandale der etablierten Konfessionen; oder sie thematisieren den Umgang mit der in Deutschland vermeintlich „neuen“ Religion des Islam, der wechselweise als fremd oder terroristisch, auf jeden Fall aber als Bedrohung wahrgenommen wird. Die individuelle Bindung an das Überzeitliche wird hier als Bedrohung für die Gesellschaft skizziert und diese vor allem „außen“ verortet. Der Islam gilt als Gefahr, die den gesellschaftlichen Frieden infrage stellt. Dass dieser Gefährdungswahrnehmung von Teilen des Rechtspopulismus das „christliche Abendland“ als politische Zielvision und Abwehrmechanismus entgegengehalten wird, ist auf den ersten Blick ein verwirrender Befund, schließt aber – so lässt sich bei genauerem Hinsehen zeigen – durchaus an die anfänglichen Beobachtungen an.
Die Deutschen, so hat eine empirische Befragung des Exzellenzclusters Religion und Politik aus dem Jahr 2010 ergeben, haben einen wesentlich kritischeren Blick auf den Islam als bspw. ihre europäischen Nachbarn in Frankreich, Dänemark oder den Niederlanden. Stärker als die dortige Bevölkerung sind sie gegen den Bau von Moscheen oder Minaretten und lehnen es ab, den Anhängern anderer Religionen gleiche Rechte zuzugestehen.[2] Es sind nicht direkte Kontakte zu Muslimen, die diese Anschauung prägen, im Gegenteil: In Deutschland, so gaben die Befragten an, gibt es besonders wenige Kontakte zwischen nicht-muslimischen Deutschen und Angehörigen islamischer Glaubensgemeinschaften. Es ist, meines Erachtens, diese besondere Konstellation einer „hinkenden Trennung“ von Kirchen und Staat, starker Säkularisierung und gleichzeitiger innerer Auszehrung im Christentum, die diese demoskopischen Trends erklärbar macht.
Dabei ist islamisches Leben in Deutschland keineswegs ein neues Phänomen. Bereits seit dem 19. Jahrhundert hat es Muslime in Deutschland gegeben. Aber erst mit der Arbeitsmigration der 1960er Jahre, v.a. aus der Türkei, wuchs die islamische Gemeinschaft in der Bundesrepublik zu einer sozial, politisch und religiös bedeutsamen Größe, die auch öffentlich registriert wurde. Auch die Wahrnehmung der Einwandernden als religiöse Menschen fand zeitverzögert statt: Die gesellschaftliche Selbstverständigung über die Migration kam in den 1970er Jahren weitgehend ohne Bezug auf den Islam aus. Nach zeitgenössischer Ansicht waren es v.a. Arbeitskräfte auf Zeit, sogenannte Gastarbeiter, die nach Deutschland kamen, sodass sich die Frage nach ihrer Religion oder anderen Einstellungen erübrigte. Zudem waren sie eingeschlossen in die weitverbreitete Annahme einer mit der Modernisierung einhergehenden generellen Säkularisierung. Warum also die Religiosität dieser Menschen berücksichtigen, wenn sich diese im modernisierenden Deutschland doch bald erübrigen würde? Muslimische Religionspraxis zog sich in die Hinterhofmoschee zurück.
Im Verlauf der 1970er Jahre wandelte sich dann die Wahrnehmung des Islam in Deutschland. Ein Beispiel dafür ist eine Titelgeschichte von 1973: Unter der Schlagzeile „Religion im Angriff“ konstatierten die Redakteure eine „beispiellose Welle der Re-Islamisierung“, die auch auf heimische Gefilde überzuschwappen drohe. „300 Jahre nach seinem letzten Angriff auf das Abendland“, so erklärte das Blatt, „sei der „Islam den Europäern wieder auf den Leib gerückt“. Und so begegne man ihm „heute auch im Westen: in den Ghettos von New York und Chicago, in französischen Vorstädten, in der englischen Provinz, und eben auch in bundesdeutschen Gastarbeiterquartieren“. Dieses Zitat stammt nicht etwa aus einem rechtsradikalen Hetzblatt, sondern aus dem Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel.[3]
Für diesen Wandel in der Wahrnehmung waren weniger deutschlandspezifische, sondern internationale Entwicklungen entscheidend: der Bürgerkrieg der maronitischen Phalange-Miliz und der PLO im Libanon seit Ende der 1960er Jahre, die Machtübernahme Idi Amins in Uganda 1971, 1979 dann die iranische Revolution, in deren Folge der in Deutschland bis in die Klatschblätter hinein populäre persische Schah Mohammad Rheza Pahlavi und seine Frau durch den Ajatholla Khomenei abgelöst wurden. Erst in diesem Diskurs der 1970er und 1980er Jahre wurden aus den einwandernden Türken, Afghanen, Pakistani und den Angehörigen arabischer Länder die Muslime und aus deren Religion der Islam. Nicht soziale, politische oder kulturelle Belange vereinten nun in der Wahrnehmung die Gruppe der Migranten und Migrantinnen, sondern vor allem deren Religiosität. Mit dieser Engführung wurde nicht nur die Vielfalt von Interessen und Positionen innerhalb dieser heterogenen Gruppe beiseite gewischt; auch die internen Veränderungen in der Religiosität der Einwanderer blieben unberücksichtigt.
Wie stark dieser Trend zur Essentialisierung ist, zeigt sich bspw. auch in den zwischen 2006 und 2009 vom Innenministerium des Bundes abgehaltenen „Islamkonferenzen“. Mit dem Anschlag auf die Twin Towers in New York am 11. September 2001 und vielen weiteren terroristisch-islamistischen Anschlägen blieb auch das Bedrohungsszenario lebendig. In dieser Verständigung über die Einwanderung nach Deutschland wuchs der Islam zu einer imaginierten homogenen Glaubensgemeinschaft globalen Ausmaßes heran, welche die eigene Wertordnung zu erschüttern drohte.
Infolge dieses Prozesses entdeckten auch Kreise, die mit den Kirchen nichts am Hut hatten, die „jüdisch-christliche Tradition“ für sich, um sich in einem Akt der cultural defence gegen „den Islam“ zu positionieren. Der Bezug auf Religion entwickelte sich dabei eher abstrakt. Nicht Jesus Christus als Gottes Sohn, sondern das Abendland als u.a. kulturchristliche Schimäre standen dabei im Vordergrund. In diesen Abwehrreflexen gewann und gewinnt das Christentum nicht als religiöse Überzeugung an Gewicht, sondern vor allem als Traditionselement eines „abendländischen“ Kulturkreises. Das Läuten von Kirchenglocken erscheint vor diesem Hintergrund weniger als Einladung zu Messfeier oder Gottesdienst, sondern – wie in den rechtspopulistischen Bewegungen der vergangenen Jahre verhandelt – vor allem als Teil des Brauchtums, der nationalen Identitätspflege und eines xenophoben Abwehrdiskurses.
Für die Zukunft sind Historiker professionell nicht zuständig. Dennoch lassen sich in aller Vorsicht drei Schlüsse aus den gemachten Beobachtungen ziehen. Erstens: Wollen die Kirchen selbst ihre jetzige Stellung zumindest in Ansätzen bewahren, dann werden sie sich mühen müssen, nicht nur als Organisationen stark zu bleiben, sondern auch attraktiver für diejenigen zu werden, die tatsächlich religiös suchen. Ferner darf, zweitens, die Erinnerungskultur an religiöse Ereignisse nicht zum Eventmarketing verkommen. Luther wird es danken, wenn man ihm 2017 die Ehre gönnt, auch in seinen religiösen Anliegen und Anstößen wahrgenommen zu werden. Drittens wird die Religionspolitik in der Bundesrepublik verstärkt darauf abzielen müssen, eine gleiche Nähe oder eine gleiche Distanz zu den in Deutschland beheimateten Religionsgemeinschaften zu halten.
Aus einer solchen Äquidistanz lässt sich dann trefflich einfordern, was allen Bundesbürgern gemein ist: die Verpflichtung auf die im Grundgesetz niedergelegte Verfassung und das (weltliche) Recht. Dass in einer solchen Konstellation neben dem Judentum und den christlichen Konfessionen nicht nur die Muslime, sondern auch der Islam dazugehört, ist nicht nur politisch geboten, sondern auf Grundlage des Grundgesetzes selbstverständlich.
Prof. Dr. Thomas Großbölting, geb. 1969, ist nach Stationen in Berlin, Magdeburg und Toronto Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der WWU Münster.
Der Text ist eine gekürzte Fassung des Originalbeitrags, der in der INDES-Ausgabe 1-2017 erschienen ist: Luthergedenken – Kirchenkrise – Islamophobie. Zeithistorische Beobachtungen zum religiösen Feld in Deutschland.
[1] Siehe Deckers, Daniel: Kirche schafft sich ab, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.11.2017.
[2] Vgl. Pollack, Detlef: Studie „Wahrnehmung und Akzeptanz religiöser Vielfalt“. Bevölkerungsumfrage des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ unter Leitung des Religionssoziologen Prof. Dr. Detlef Pollack, Dezember 2010, URL: https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/religion_und_politik/aktuelles/2010/12_2010/studie_wahrnehmung_und_akzeptanz_religioeser_vielfalt.pdf [eingesehen am 28.02.2017]; vgl. auch Ders. et al.: Grenzen der Toleranz. Wahrnehmung und Akzeptanz religiöser Vielfalt in Europa, Wiesbaden 2014.
[3] Siehe o.V.: Mohammeds Lehre: Religion im Angriff, in: Der Spiegel, 23.04.1973.
